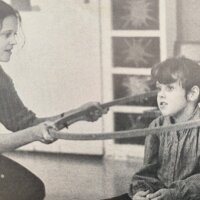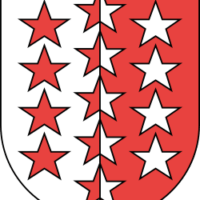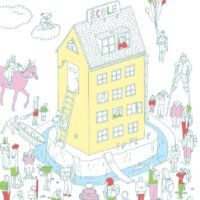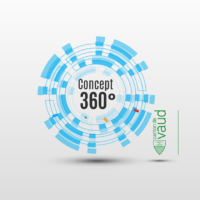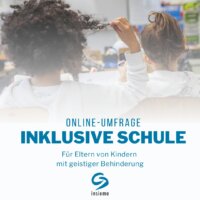Drei Modelle haben die Geschichte der Sonderpädagogik geprägt. Das separative Modell dominierte bis in die 1960er-Jahre. Es zeichnete sich durch die Einrichtung von Sonderklassen für Schüler*innen mit besonderen Bedürfnissen aus.
Das integrative Modell versucht, die Schüler in die Regelklassen zu integrieren und ihnen persönliche Unterstützung zu bieten.
In den 1990er-Jahren entstand das inklusive Modell, das auf die Schaffung eines Bildungssystems abzielt, in dem alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihren individuellen Fähigkeiten gemeinsam in regulären Klassen unterrichtet werden. Diese drei Modelle lösen einander nicht ab, sondern überlagern sich.
1968
Erste Revision des IVG
Einführung der heilpädagogischen Früherziehung
1971
Gründung des «Service de l’enseignement spécialisé» im Kanton Waadt
1978
Integrationsexperiment in Sursee (LU)
Auszug aus dem insieme-Magazin, damals «appell»
Die Heilpädagogische Sonderschule Sursee war in den sechziger Jahren im ganzen Städtchen zerstreut […]. Der Stadtammann machte den Vorschlag, Schulzimmer im neuen Schulhaus Kotten zu nutzen. Zu Beginn des Versuchs hegten nicht wenige Lehrer Bedenken […]. Inzwischen sind die Vorbehalte geschwunden […]. Nicht eingetreten ist, was anfangs zusätzlich befürchtet wurde: Eltern, die sich beklagen, die ihre normalen Kinder nicht mit solchen «Dubelis» im gleichen Schulhaus sehen wollen.
1980
Sabine besucht den regulären Kindergarten
Auszug aus dem insieme-Magazin, damals «appell»
Ihre Lehrerin berichtet: «Für mich ist es ein faszinierendes Experiment und den anderen Kindern tut Sabine auch gut. Sie wissen jetzt, dass ein behindertes Kind nicht einfach blöd ist oder gar gefährlich und, dass man durchaus mit ihm spielen und reden kann.»
1989
In der Sackgasse der Integration
Auszug aus dem insieme-Magazin, damals «appell»
«Ich bin seit meiner Geburt cerebral geschädigt und habe eine normale Hilfsschule besucht. Auch ich wurde viel ausgelacht und gehänselt, es tat mir manchmal sehr weh.»
1990er-Jahre
Bildungsreformen in mehreren Kantonen
Mit den Reformen soll ein inklusiver Ansatz gefördert werden, der Massnahmen zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen in die Regelschulen vorsieht. Gründung mehrerer Fachhochschulen und Pädagogischer Hochschulen.
1994
Gibt es bald nur noch Studierte und Laien?
Auszug aus dem insieme-Magazin
Rückblick auf das Projekt zur Einführung von Fachhochschulen: Elternvereine und Behinderteninstitutionen machen sich Sorgen über die zunehmende «Verbildung» der Betreuerinnen und Betreuer. Sie haben Angst, dass es mit der bevorstehenden Einführung der Fachhochschulen nur noch Studierte und Laien geben wird, Angst, dass die Behinderten dann zu kurz kommen.
1994
Annahme der Salamanca-Erklärung der UNESCO durch die Schweiz
Die Salamanca-Erklärung hat zum Ziel, inklusive Bildung zu fördern. Sie betont die Notwendigkeit, Schulen so zu gestalten, dass sie alle Kinder aufnehmen und unterstützen, insbesondere jene mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen.
1995
Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen
2004
Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) tritt in Kraft
Das BehiG verlangt von den Kantonen, dass sie die Integration von Schülerinnen und Schülern mit Behinderungen in die Regelschule durch geeignete Schulformen fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des Kindes oder der Jugendlichen bzw.des Jugendlichen dient (Art. 20 Abs. 1 und 2 BehiG).
2007
Interkantonale Vereinbarung über die Sonderpädagogik
Die Konkordatskantone definieren das Grundangebot, das die Ausbildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf sicherstellt. Sie fördern die Integration dieser Kinder und Jugendlichen in die Regelschule und verpflichten sich, gemeinsame Instrumente zu verwenden.
2015
Agenda der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung
Ziel 4 besteht darin, «eine hochwertige, inklusive und gleichberechtigte Bildung zu gewährleisten und die Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle zu fördern».
2015
Geschichte zweier Wege zur schulischen Integration in Genf
Auszüge aus dem insieme-Magazin
«Anfangs sagte man uns, alles sei möglich. Doch dann wurde auf einmal entschieden, dass Sacha nur zu 50% integriert werden soll.» «Alexis hat einen Bruder und eine Schwester, die beide älter sind als er. Daher war unsere Familie im Kindergarten bereits bekannt, als wir ankündigten, dass unser drittes Kind behindert ist. Die Verantwortlichen haben uns sofort versichert, dass wir uns keine Sorgen machen sollten und dass sie Alexis selbstverständlich willkommen heissen.»
2023
Inklusives Co-Teaching als Zukunftsversprechen
Auszüge aus dem insieme-Magazin
Zwei Lehrerinnen im Kanton Waadt teilen sich eine Klasse, in der zehn Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf integriert sind. Die Präsenz von zwei «Lehrerinnen» ist von Vorteil, da «sie sich so besser um uns kümmern können», sagen die Schülerinnen […]. «Sie hilft dir bei Tests und Diktaten», erklärt Isra ihrer Mitschülerin Hanna, deren Lernschwierigkeiten «kein Grund sind, nicht befreundet zu sein».